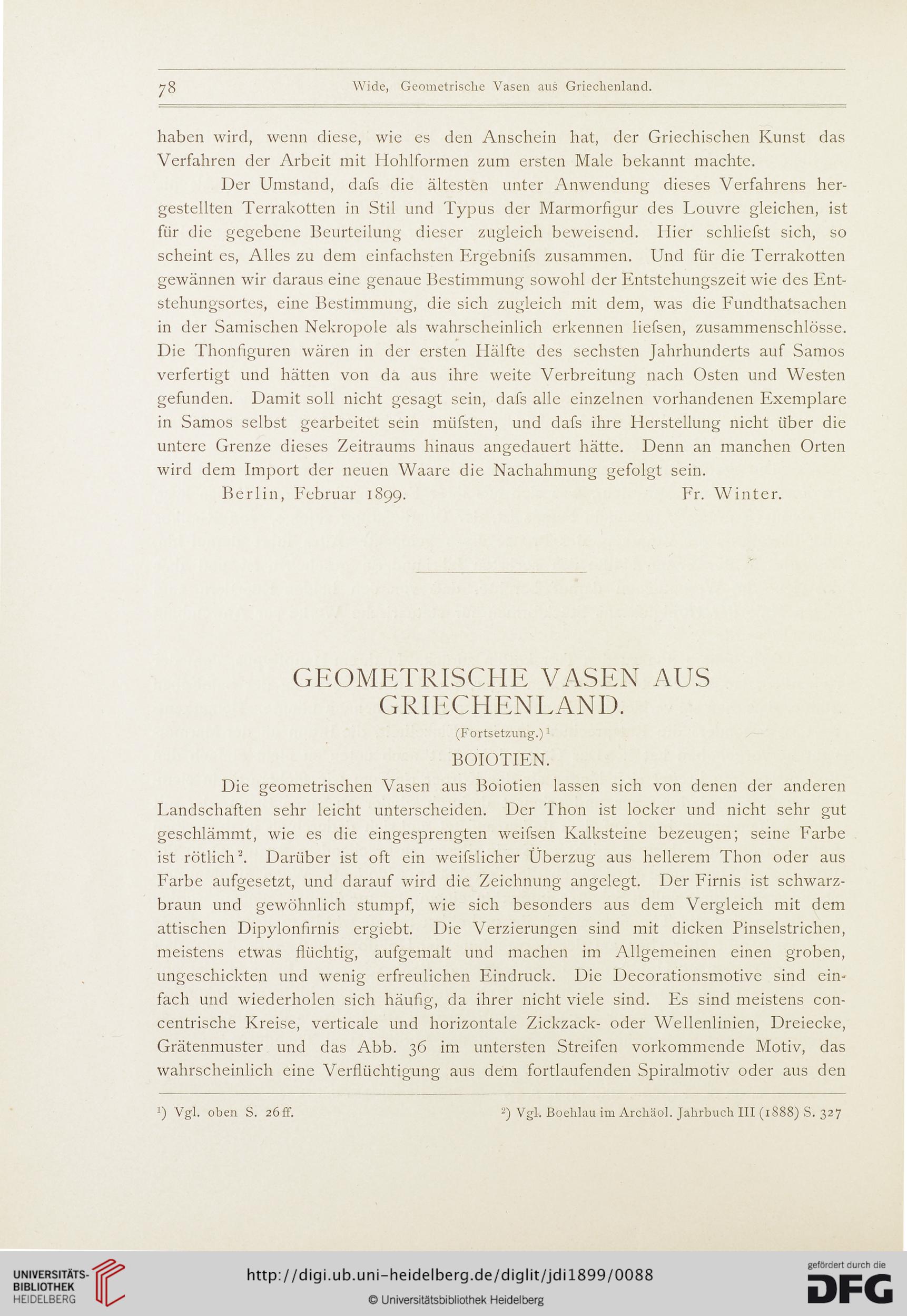Wide, Geometrische Vasen aus Griechenland.
78
haben wird, wenn diese, wie es den Anschein hat, der Griechischen Kunst das
Verfahren der Arbeit mit Hohlformen zum ersten Male bekannt machte.
Der Umstand, dafs die ältesten unter Anwendung dieses Verfahrens her-
gestellten Terrakotten in Stil und Typus der Marmorfigur des Louvre gleichen, ist
für die gegebene Beurteilung dieser zugleich beweisend. Hier schliefst sich, so
scheint es, Alles zu dem einfachsten Ergebnifs zusammen. Und für die Terrakotten
gewännen wir daraus eine genaue Bestimmung sowohl der Entstehungszeit wie des Ent-
stehungsortes, eine Bestimmung, die sich zugleich mit dem, was die Fundthatsachen
in der Samischen Nekropole als wahrscheinlich erkennen liefsen, zusammenschlösse.
Die Thonfiguren wären in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts auf Samos
verfertigt und hätten von da aus ihre weite Verbreitung nach. Osten und Westen
gefunden. Damit soll nicht gesagt sein, dafs alle einzelnen vorhandenen Exemplare
in Samos selbst gearbeitet sein müfsten, und dafs ihre Herstellung nicht über die
untere Grenze dieses Zeitraums hinaus angedauert hätte. Denn an manchen Orten
wird dem Import der neuen Waare die Nachahmung gefolgt sein.
Berlin, Februar 1899. Fr. Winter.
GEOMETRISCHE VASEN AUS
GRIECHENLAND.
(Fortsetzung.)1
BOIOTIEN.
Die geometrischen Vasen aus Boiotien lassen sich von denen der anderen
Landschaften sehr leicht unterscheiden. Der Thon ist locker und nicht sehr gut
geschlämmt, wie es die eingesprengten weifsen Kalksteine bezeugen; seine Farbe
ist rötlich2. Darüber ist oft ein weifslicher Überzug aus hellerem Thon oder aus
Farbe aufgesetzt, und darauf wird die Zeichnung angelegt. Der Firnis ist schwarz-
braun und gewöhnlich stumpf, wie sich besonders aus dem Vergleich mit dem
attischen Dipylonfirnis ergiebt. Die Verzierungen sind mit dicken Pinselstrichen,
meistens etwas flüchtig, aufgemalt und machen im Allgemeinen einen groben,
ungeschickten und wenig erfreulichen Eindruck. Die Decorationsmotive sind ein-
fach und wiederholen sich häufig, da ihrer nicht viele sind. Es sind meistens con-
centrische Kreise, verticale und horizontale Zickzack- oder Wellenlinien, Dreiecke,
Grätenmuster und das Abb. 36 im untersten Streifen vorkommende Motiv, das
wahrscheinlich eine Verflüchtigung aus dem fortlaufenden Spiralmotiv oder aus den
l) Vgl. oben S. 26 ff.
-) Vgl·. Boelilau im Archäol. Jahrbuch III (1888) S. 327
78
haben wird, wenn diese, wie es den Anschein hat, der Griechischen Kunst das
Verfahren der Arbeit mit Hohlformen zum ersten Male bekannt machte.
Der Umstand, dafs die ältesten unter Anwendung dieses Verfahrens her-
gestellten Terrakotten in Stil und Typus der Marmorfigur des Louvre gleichen, ist
für die gegebene Beurteilung dieser zugleich beweisend. Hier schliefst sich, so
scheint es, Alles zu dem einfachsten Ergebnifs zusammen. Und für die Terrakotten
gewännen wir daraus eine genaue Bestimmung sowohl der Entstehungszeit wie des Ent-
stehungsortes, eine Bestimmung, die sich zugleich mit dem, was die Fundthatsachen
in der Samischen Nekropole als wahrscheinlich erkennen liefsen, zusammenschlösse.
Die Thonfiguren wären in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts auf Samos
verfertigt und hätten von da aus ihre weite Verbreitung nach. Osten und Westen
gefunden. Damit soll nicht gesagt sein, dafs alle einzelnen vorhandenen Exemplare
in Samos selbst gearbeitet sein müfsten, und dafs ihre Herstellung nicht über die
untere Grenze dieses Zeitraums hinaus angedauert hätte. Denn an manchen Orten
wird dem Import der neuen Waare die Nachahmung gefolgt sein.
Berlin, Februar 1899. Fr. Winter.
GEOMETRISCHE VASEN AUS
GRIECHENLAND.
(Fortsetzung.)1
BOIOTIEN.
Die geometrischen Vasen aus Boiotien lassen sich von denen der anderen
Landschaften sehr leicht unterscheiden. Der Thon ist locker und nicht sehr gut
geschlämmt, wie es die eingesprengten weifsen Kalksteine bezeugen; seine Farbe
ist rötlich2. Darüber ist oft ein weifslicher Überzug aus hellerem Thon oder aus
Farbe aufgesetzt, und darauf wird die Zeichnung angelegt. Der Firnis ist schwarz-
braun und gewöhnlich stumpf, wie sich besonders aus dem Vergleich mit dem
attischen Dipylonfirnis ergiebt. Die Verzierungen sind mit dicken Pinselstrichen,
meistens etwas flüchtig, aufgemalt und machen im Allgemeinen einen groben,
ungeschickten und wenig erfreulichen Eindruck. Die Decorationsmotive sind ein-
fach und wiederholen sich häufig, da ihrer nicht viele sind. Es sind meistens con-
centrische Kreise, verticale und horizontale Zickzack- oder Wellenlinien, Dreiecke,
Grätenmuster und das Abb. 36 im untersten Streifen vorkommende Motiv, das
wahrscheinlich eine Verflüchtigung aus dem fortlaufenden Spiralmotiv oder aus den
l) Vgl. oben S. 26 ff.
-) Vgl·. Boelilau im Archäol. Jahrbuch III (1888) S. 327